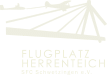Auf dieser Seite möchten wir Euch einen Überblick über Fragen geben, die sich (angehende) Schüler und Piloten bei uns am Häufigsten stellen. Sollte trotzdem noch etwas unklar sein, wendet Euch gerne jederzeit an einen unserer Ansprechpartner.
Mit einem “normalen” Segelflugzeug ist im allgemeinen einfacher Kunstflug wie Looping oder Trudeln möglich. Für andere Figuren ist es gewöhnlich nicht zugelassen. Hierfür gibt es speziell für Kunstflug ausgelegte Segelflugzeuge, mit denen auch alle Kunstflugfiguren geflogen werden können. Aufgrund des fehlenden Motors ist allerdings der Segelkunstflug erheblich schwieriger als der Motorkunstflug.
Abgesehen davon, daß das Segelflugzeug für Kunstflug zugelassen sein muß (logisch), muß auch der Pilot unabhängig vom Flugschein eine Kunstflugberechtigung besitzen, bevor er am Himmel turnen darf.
Moderne Segelflugzeuge haben einen Geschwindigkeitsbereich von ca. 60 bis 250 km/h. Die Geschwindigkeit im Geradeausflug liegt normalerweise zwischen 90 und 120 km/h.
Man muß dabei wissen, daß die einzige Möglichkeit, ein Segelflugzeug zu beschleunigen, darin besteht, das Segelflugzeug steiler nach unten gleiten zu lassen. Geschwindigkeitserhöhung bringt daher stets auch stärkeres Sinken mit sich, weshalb man sich hohe Geschwindigkeiten nur bei guter Thermik und großer Ausgangshöhe leisten kann.
Wie bei anderen Sportarten gibt es auch beim Segelfliegen Wettkämpfe und Meisterschaften. Diese dauern meist ein bis zwei Wochen, in denen die Teilnehmer bestimmte Streckenflüge durchführen müssen, welche von der Wettbewerbsleitung ausgeschrieben werden. Bewertet wird nach der Durchschnittsgeschwindigkeit bzw. der bewältigten Strecke. Aber auch die unterschiedlichen Gleitflugleistungen der Flugzeuge werden berücksichtigt.
Bei der Weltmeisterschaft 1997 in St.Auban in Frankreich konnte Deutschland dieses Mal in drei verschiedenen Kategorien insgesamt einen ersten, zweiten und dritten Platz erringen.
Wenn das Segelflugzeug in der Thermik Höhe gewonnen hat, kann es diese Höhe im Geradeausflug wieder abgleiten. An guten Tagen kann man auch im Flachland bis zu 2000 Meter Höhe erreichen. Ein durchschnittliches Segelflugzeug kann aus dieser Höhe etwa 60 – 70 Kilometer weit gleiten, ohne erneut Höhe zu “tanken”. Wenn die Höhe geschrumpft ist, schaut sich der Pilot natürlich rechtzeitig nach der nächsten Thermikquelle um, mit der er sich wieder die für den Weiterflug nötige Höhe verschaffen kann. Auf diese Weise kann er je nach Thermik große Strecken zurücklegen.
Wenn die Thermik gut ist, fliegen viele Segelflieger als persönliche Herausforderung solche Strecken (meist Dreiecksflüge vom eigenen Flugplatz über zwei Wendepunkte und wieder zurück). Dabei werden die Wendepunkte mit einem Foto dokumentiert, und der Pilot kann sich diese Strecke dann in der deutschen Streckenflugwertung anrechnen lassen.
Wenn man vom Flugplatz weggeflogen ist und schon zu niedrig ist, um zurückzufliegen, und auch kein anderer Flugplatz in Reichweite ist, dann landet man auf einer Wiese oder einem Acker. Dies ist ein völlig normaler Vorgang und gehört zum Segelfliegen dazu. Man sucht sich die Landefläche aus der Luft sorgfältig aus und landet dann wie auf dem Flugplatz. Jedes Segelflugzeug ist hierfür konstruiert.
Leider schreiben Zeitungen dabei noch des öfteren von einer “Notlandung, bei dem es dem Piloten gelang, das Flugzeug heil auf den Boden zu bringen”…..
Wenn man keine Thermik mehr findet oder die Thermik gegen Abend aufhört, dann gleitet man die restliche Höhe ab und landet wieder auf dem Flugplatz.
Da das Segelflugzeug keinen eigenen Antrieb besitzt, ist sein Flug ein ständiger Gleitflug, d.h. er ist mit Höhenverlust verbunden.
Wenn nun aber die Sonne den Boden erwärmt, dann bilden sich (besonders über dunklen Flächen) am Boden Warmluftpolster, die irgendwann in schlauchartiger Form nach oben steigen. Diese aufsteigende Warmluft nennt man Thermik. Fliegt das Segelflugzeug in einen solchen Thermikschlauch, dann kann der Pilot durch Kreisen innerhalb des Aufwinds bleiben und wird mit der Warmluft “nach oben geschwemmt”. Auf diese Weise kann er Höhe gewinnen, die er beim Geradeausfliegen wieder in Strecke umsetzen kann. An guten Tagen kann man so durchaus mehrere Stunden fliegen und auch größere Strecken zurücklegen. Und das alles ohne Motor, nur mit Sonnenenergie!
Bei der meisten Art von Flügen ist das Mitführen eines Fallschirms aus Sicherheitsgründen vorgeschrieben. Wie man aber der Statistik entnehmen kann, wird der Fallschirm nur sehr, sehr selten benötigt.
Da ein Segelflugzeug keinen Motor besitzt, benötigt es eine Hilfe, um auf eine bestimmte Ausgangshöhe zu gelangen. Heutzutage gibt es dafür zwei verschiedene Startmethoden: den Windenstart und den Flugzeugschlepp. Beim Windenstart wird das Segelflugzeug an einer Motorwinde wie ein Drachen in die Höhe gezogen. Diese Winden werden aus LKW-Motoren gebaut und leisten zwischen 250 und 350 PS.
Beim Flugzeugschlepp wird das Segelflugzeug mit einem 30 – 40 Meter langen Seil hinter ein Motorflugzeug gehängt. Dann startet das Motorflugzeug und zieht das Segelflugzeug mit sich hinauf, bis der Segelflugzeugpilot das Seil ausklinkt.
Aus seiner Ausgangshöhe nach dem Start gleitet das Segelflugzeug dann langsam abwärts, bis es wieder auf dem Flugplatz landet.
Ältere Segelflugzeuge sind noch in der Art aufgebaut, die man von früher kennt: Stahlrohrrumpf und holzbeplankte, mit Leinwand bespannte Tragflächen. Die modernen Segelflugzeuge werden in Faserverbundbauweise hergestellt. Hochwertige und hochfeste Materialien wie GfK, CfK oder Aramidfaser sind hier im Einsatz. Die Oberflächen sind spiegelglatt und tragen so zur Widerstandsverminderung bei. Schau für Infos auch mal in unseren Flugzeugpark!
Natürlich nicht, sonst gäbe es sehr viel weniger Segelflieger. Der Verein stellt Flugzeuge zur Verfügung, auf denen geschult und später auch auf Leistung geflogen werden kann.
Ja. Segelfliegen ist nur im Verein möglich, da man für das Ausüben dieses Hobbies die Hilfe von anderen braucht. Ein einzelner kommt nur durch seine Kameraden in die Luft, die ihm beim Aufrüsten und Starten helfen.
Hin und wieder leider ja, in den meisten Fällen aber nicht. Wenn die Brille nicht allzu stark ist, bekommt man im Normalfall lediglich einen Eintrag in den Flugschein, daß die Brille beim Fliegen getragen werden muß. Piloten, die mit einer Brille fliegen, haben beim Fliegen dadurch keine Nachteile. Auch mit Kontaktlinsen darf geflogen werden. Wichtig ist, dass immer eine Ersatzbrille mitgeführt werden muss.
Für die Ausbildung und den späteren Flugschein benötigt man ein fliegerärztliches Tauglichkeitszeugnis sowie ein polizeiliches Führungszeugnis. Für ersteres ist eine ganz normale, passable körperliche Konstitution ausreichend, fürs zweite ist man selbst verantwortlich.
Neben diesen Voraussetzungen ist fürs Segelfliegen vor allem Teamgeist erforderlich.